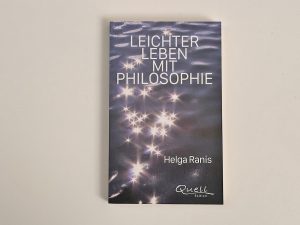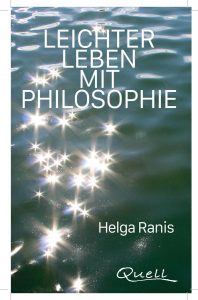Philosophie für Zwischendurch: Vom Platonismus zur Dogmenbildung
Die nach dem Philosophen Platon als Platonismus bezeichnete philosophische Richtung wurde in der Zeit zwischen 50 und 250 n. Chr. als Mittelplatonismus bezeichnet. Nach der Lehre des Aristoteles haben alle Lebewesen und Objekte eine Funktion oder einen Zweck, die er als „Telos“ bezeichnet. Die mittelplatonische Ethik sieht das Ziel beziehungsweise. den Zweck (Telos) menschlicher Existenz in dem Ähnlich werden mit Gott, das durch die Erkenntnis erfolgt. Diese Telosformel wurde von der christlichen Theologie weitgehend übernommen. Außerdem wurde die mittelplatonische Metaphysik von der Frage bestimmt, wie die Vermittlung des Transzendenten (des Göttlichen) in die Welt hineingedacht werden muss, das heißt, wie es von der ursprünglichen Einheit des Seins zur Vielheit komme. Es musste also das Problem der Trinität, der Dreieinigkeit Gottes, geklärt werden, was zu kontroversen Diskussionen führte. Origenes, der neben Augustinus bedeutendste Theologe der alten Kirche konzipierte eine Trinitätslehre, die sowohl auf dem Platonismus (Gott als höchstes Prinzip) als auch auf den Inhalten der apostolischen Verkündigung und der kirchlichen Glaubensregel beruht. Nach Origenes ist Gott das uranfängliche Prinzip, der Grund des Seins. Er ist völlig transzendent, übersteigt alles Denken und Sein und ist reine Einheit und reiner Geist. Hier nimmt Origenes Bezug auf die platonische Ideenlehre. Zu Gottes Wesen gehört aber auch die Mitteilung seiner Güte, deshalb erschafft er die Welt. Er erzeugt – biblisch gesprochen – einen Sohn, seinen Logos, den Schöpfungsmittler, den Origenes als abgeleitete Hypostase Gottes bezeichnet. Er hat also eine eigenständige Wirklichkeit. Dieser wiederum erschafft die Geistwesen, den Heiligen Geist und die Engel. Der Heilige Geist wäre ebenfalls eine Hypostase, so dass Origenes von einem Gott in drei Erscheinungsformen (Hypostasen) spricht. Origenes´ Kontrahent war der Theologe Arius, der die Lehre von der Geschöpflichkeit Christi im Sinne einer Ungleichheit beziehungsweise einer Unterordnung Christi vertrat. Er war der Auffassung, dass es zwischen Gott und Jesus Christus eine Hierarchie gäbe. Diese innerkirchlichen Konflikte waren bedeutend, weil durch die Verbindung mit dem Staat die Einheit der Kirche für die innere Stabilität des Reiches wichtig wurde. Aus diesem Grund waren die Kaiser an einer dogmatisch fixierten Lehreinheit interessiert. Das Konzil von Nicäa (325 n.Chr.) war das erste Konzil, auf dem ein Reichsdogma beschlossen wurde. Hier wurde das neue Lehrbekenntnis als ein reichsweit gültiges Dogma gebilligt und vom Kaiser anerkannt. Die Hauptaussage dieses Dogmas lautet: „Als Sohn ist Christus wahrer Gott aus dem Sein des Vaters, wesenseins mit diesem (homousios). Nachdem das Christentum zur Staatsreligion erhoben worden war, fand 381 das erste Konzil von Konstantinopel statt. Hier wurde das Dogma des Konzils von Nicäa nochmal bestätigt und das Nicänisch-konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis formuliert. Dieses Glaubensbekenntnis wurde in die Gesangbücher mitaufgenommen und wird auch an bisweilen besonderen Feiertagen in der Kirche gesprochen. Nachdem das trinitarische Problem dogmatisch gelöst worden war, stellte sich die Frage nach der Natur Jesu Christi, das heißt, ob er göttlicher und/oder menschlicher Natur sei. Dieses Problem wurde als Zwei-Naturen-Lehre bekannt. Auch diese Frage wurde wieder kontrovers diskutiert. Auf dem Konzil von Chalcedon (451) wurde das Dogma manifestiert, dass Jesus Christus eine Person, in zwei Naturen, einer göttlichen und einer menschlichen, sei. Daraus ergibt sich, dass sich zwei Willen und zwei Energien in seiner Person vereinigen. Dieses wurde 681 auf dem Konzil von Konstantinopel dogmatisiert, außerdem wurde die Entscheidung des Konzils von Chalcedon bekräftigt. Auf dem Konzil von Nicäa 787 wurde die Bilderverehrung dogmatisiert. Jesus Christus, im platonischen Sinn Bild oder Idee Gottes ermöglicht als Mensch eine Darstellung der unsichtbaren, göttlichen Wirklichkeit. In seiner Menschheit, die abgebildet werden kann, manifestiert sich die gesamte Gottheit. Die Ikone als Abbild verweist auf das himmlische Urbild. Die kultische Bilderverehrung besteht deshalb zu Recht, weil sie allein dem Urbild gilt.
Buch-Tipp
LEICHTER LEBEN MIT PHILOSOPHIE
Helga Ranis
Edition Quell ISBN 978-3-9819936-2-2, Erscheinungstermin: 1. August 2024
Bestellen Sie bis zum 1. August zum Vobestellungspreis von 12,90 Euro statt 14,90 Euro.
Seit Jahren beschreibt Helga Ranis für www.quellonline.de die Erkenntnisse der großen Denkerinnen und Denker, die uns die Herausforderungen des Lebens leichter bewältigen lassen. Über die Jahre ist eine beeindruckende Sammlung an Rezepten und Strategien entstanden. Sie geben Inspirationen, wie die Menschen ihren Alltag gestalten können. Der Weg zur inneren Freiheit des stoischen Philosophen Epiktet fehlt in dieser philosophischen Hausapotheke ebenso wenig wie moderne Überlegungen über das Wesen der Arbeit von Axel Honneth. Das Spektrum reicht von Adorno bis Zizek.
Die Autorin Helga Ranis studierte Theologie und Philosophie und schöpft aus einem großen Fundus philosophischen Wissens.
zu bestellen im Quell-Shop
oder Telefon 02236 9491130